HOME
FREIE KUNST
GRAPGIC DESIGN
KONTAKT
![]() back
back
Am Rande meines Gartens
|
|
ein Künstlerbuch von Tanja Leonhardt (Konzept, Schrift, Miniaturen, Text) und Martin Dürk (Graphit-Zeichnungen) Format: 43 x 61,5 cm Seitenzahl: 16 Entstehung: 2023 Hardcover mit Leinenbezug (naturweiß) und
handgeschriebenem Titel (Graphit) Fadenheftung
Artistbook by Tanja Leonhardt and Martin Dürk (graphite-drawings) wide: 43 cm, high: 61,5 cm pages: 16 hardcover: Linen and handwritten title 2023
|
||
|
|
|||
|
|
 |
||
| |
|||
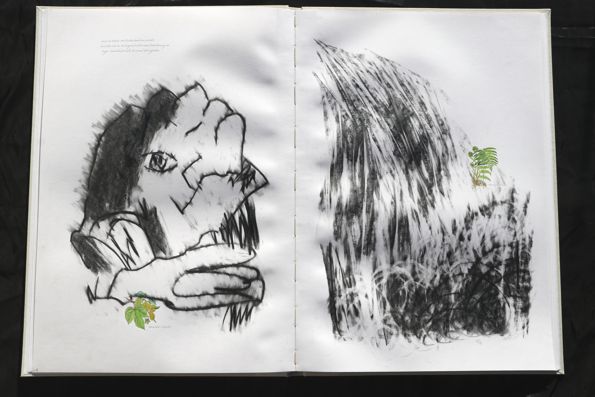 |
 |
||
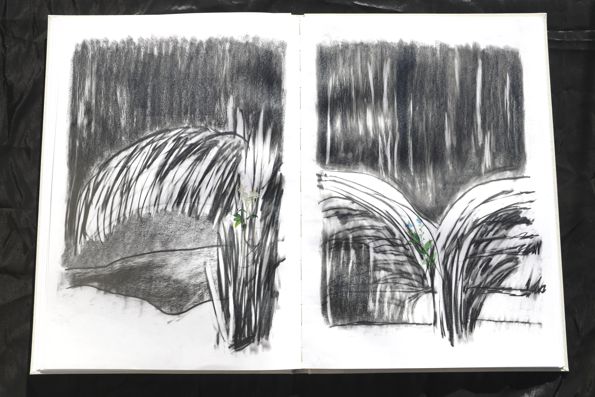 |
 |
||
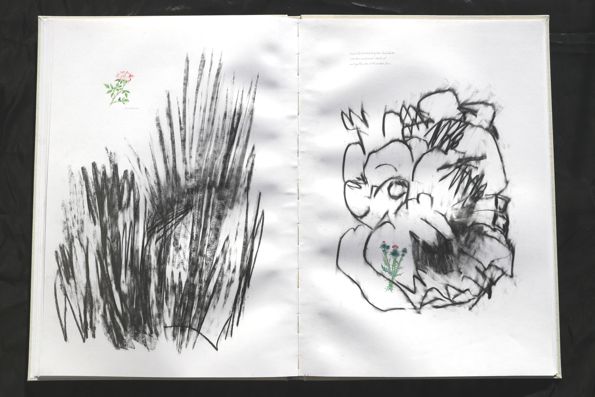 |
 |
||
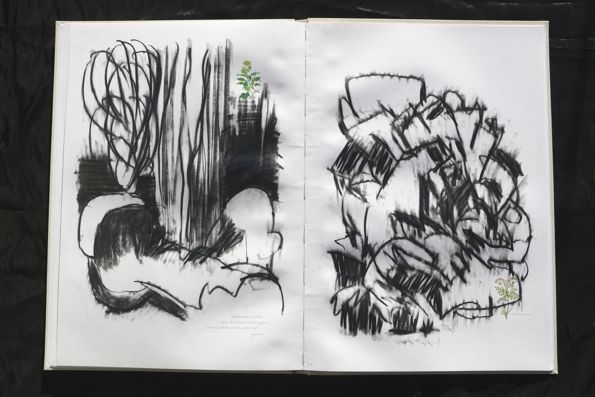 |
 |
||
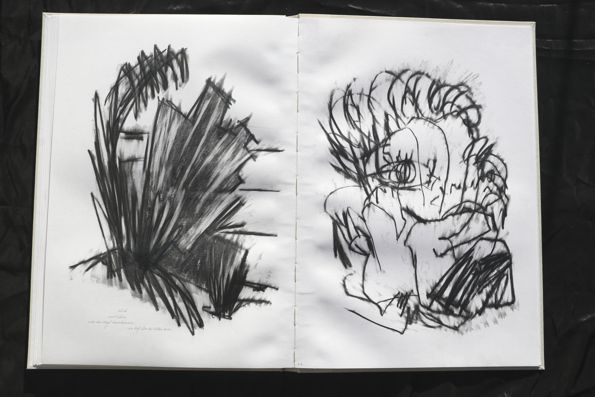 |
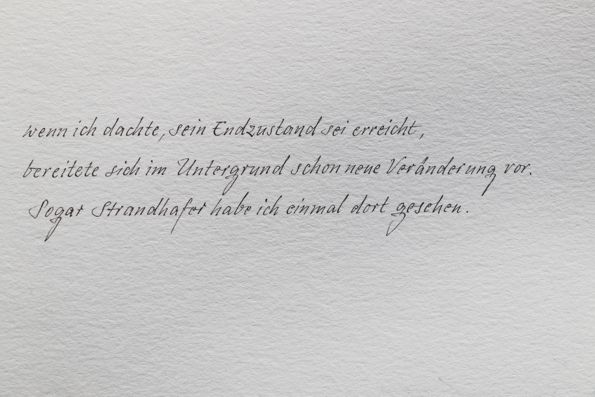 |
||
 |
|||
 |
Am Rand meines Gartens, genau auf der Grenze, ist ohne mein Zutun ein
Hügel entstanden.
Ackerwinde und Bernnessel Jahr um Jahr, Schicht um
Schicht, legten sich
Pflanzendecken darüber und vergingen. Immer,
Hopfen und Farn |
||
 |
wenn ich dachte, sein
Endzustand sei erreicht, bereitete sich im
Untergrund schon neue Veränderung vor. Sogar Strandflieder habe
ich einmal dort gesehen.
Ehrenpreis und Mädesüß Auch die hartnäckigsten
Unkräuter starben nach einer Weile
ab und gaben den Ort wieder
frei.
Wildrose und Kardedistel |
||
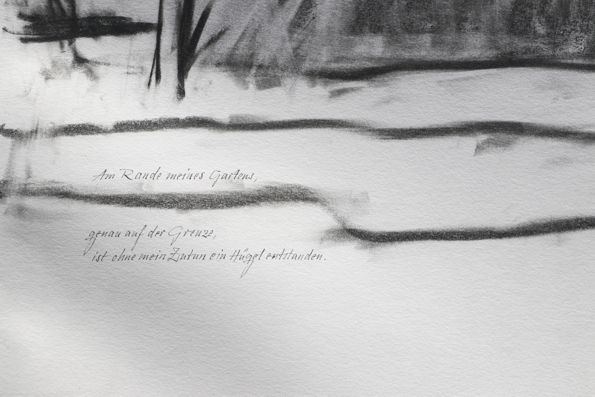 |
Manche kamen zur Blüte. Zwei Brombeeren habe ich
geerntet und einige Schlehen vor
dem ersten Frost. Gestern
Efeu und Schierling sah ich eine Füchsin unter dem Hügel hervor
kommen. Sie lief über die Felder
davon.
|
||
|
Entstehungsprozess Tanja Leonhardt erhielt eine Auswahl
von Martin Dürks Graphitzeichnungen im Format DinA-2 auf
Zeichenkarton. Die vegetabilen Motive erinnerten sie an ein
Gedicht, das sie etwa zwei Jahre zuvor geschrieben hatte,
und welches mit dem Symbolgehalt von Wildpflanzen arbeitet. Martin Dürk hatte sich zur
Entstehungszeit der Zeichnungen nicht nur mit Landschaft
(seinem Hauptthema) sondern speziell auch mit der
griechischen Mythologie auseinandergesetzt. So fanden auch
zwei Zyklopen-Zeichnungen Eingang in die Bilderauswahl für
das Gedicht, denn es geht hierbei um das Schauen eines
passiven Beobachters. Durch das Sehen wird der
Erkenntnisprozess im Text initiiert, auch, wenn es nur das
Schauen eines weit aufgerissenen Einauges ist, und somit ein
versehrtes. Tanja Leonhardt kombinierte
Blattpaare miteinander und leimte sie mit einem
Papierstreifen zusammen um heftfähige Lagen in Laufrichtung
zu erhalten. Da die Rückseiten nicht bearbeitet sind,
wechseln sich beim Blättern nun immer Doppel-Motivseiten mit
leeren Seiten ab, was wie eine Pause für das Auge darstellt. Der Text zieht sich in Strophen
durch das gesamte Buch. Aus den ursprünglich genannten
Pflanzennamen wurden Miniaturmalereien mit lateinischen
Beschriftungen in der Ästhetik alter,
wissenschaftlich-botanischer Bestimmungsbücher. In der
ursprünglichen Fassung werden die Pflanzennamen kursiv oder
farbig vom übrigen Text abgesetzt. In der gesprochenen Form
(bei Lesungen) werden sie geflüstert. Dem expressiven
Zeichenstil wird eine akribisch, minutiöse Malerei
entgegengestellt, kontrastierend in fast allen Wesenszügen -
Farbigkeit, Größe, Methode, Stil. Diese kleinen Aquarelle
wurden von Leonhardt an Stellen innerhalb der
Graphitzeichnungen platziert, an denen sich größtmögliche
Spanungs- oder Harmonieverhältnisse ergaben. Der Text soll in seiner Gestaltung
möglichst zurückgenommen erscheinen, um innerhalb der
Gesamtkomposition lediglich als ein gleichwertiger Teil
aufzutreten, nicht jedoch als Leitmotiv, dem alle anderen
untergeordnet werden. Tanja Leonhardt wählte eine
Humanistische Kursive, die nur verhaltene individuelle
Modifikationen aufweist, also keine persönliche Handschrift.
Dennoch ist sie unbedingt handgeschrieben und keinesfalls
eine maschinell gedruckte Typografie. Aber auch hier stellt
das Werkzeug einen bewussten Kontrast zur Graphitspur dar:
eine sehr feine Zeichenfeder und Aquarellfarbe. Die Künstlerin und Autorin
kombiniert in diesem Buch also den expressiven Ausdruck
großzügiger, gestischer Graphitspuren (z.T. wieder getilgt
von ebenso gestischer Radiergummispur), mit der Begrenztheit
kleinster Bewegungen in Schrift und Bild – die Schlusszeile
aus einem Gedicht Annette von Droste Hülshoffs kommt uns in
den Sinn: „… und darf nur heimlich lösen mein Haar und
lassen es flattern im Winde!"(Am Turme, 1842), in dem sie
ihr zu Passivität verurteiltes Dasein beklagt. So ist auch
das lyrische Ich ein passives. Es schaut nur und registriert
die Veränderungen an einem Ort im Garten, welcher auch
selbst schon ohne sein/ihr Zutun existiert. Die Aktion liegt
in den Händen eines anderen. Der Leser verharrt ebenso in
der Beobachterposition, bis sich zum Schluss die Parameter
verändern, und eine Füchsin den schicksalhaften, ewig
gleichen Reigen von Werden und Vergehen durchbricht und sich
entzieht. Das entsetzt starrende Zyklopenauge bleibt zurück. Die
Kombination der Arbeiten von zwei eigenständigen
Künstlerpersönlichkeiten erfolgte bei diesem Buch nicht als
eine von vornherein als Gemeinschaftsarbeit konzipierte
Buchgestaltung, sondern war ein additiver Prozess bei dem
Tanja Leonhardt intuitiv bereits bestehende Arbeiten Martin
Dürks sichtete und auswählte, als zu ihrem Thema passend.
Aber sie sind nicht nur stimmig im Dienste der Illustration
eines Textes unterwegs, sondern bringen einen unabhängigen
Entwicklungsweg und Themenkanon ins Spiel, wodurch das Motiv
A (das Gedicht) um eine Fülle anderer Motive und Impulse
erweitert wird, die sich in einem von Beginn an
konzeptuellen Miteinander wahrscheinlich nicht ergeben
hätten. Diesen Zugewinn an Bedeutung verstehen wir im Sinne
der Moderne, deren Wesen
Lévi-Strauss als
Bricolage
kennzeichnete: Zusammengebastelt macht alles viel mehr Sinn. |
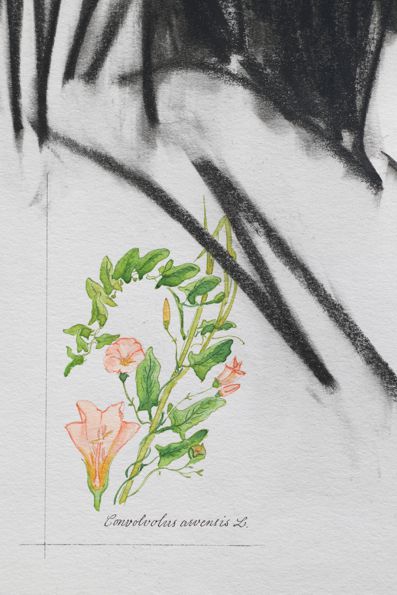 |